Oder: Der Tag, an dem ich meine eigene Heldin wurde
November 2017. Ein sozialpädagogisches Masterseminar an einer norddeutschen Hochschule. Es geht um Interventionsmöglichkeiten bei sexualisierter Gewalt. Ich bin Studentin, die an diesem Seminar teilnimmt, und habe dort etwas erlebt, was ich nicht für möglich gehalten hätte, zumindest nicht an diesem Ort.
In der vorletzten Seminarsitzung hielt ein Kommilitone ein Referat, in dem er eine Statistik vorstellte, wonach Lesben, Schwule, Trans- und Inter-Personen besonders häufig von sexueller Gewalt und Diskriminierung betroffen wären. Er merkte daraufhin an, dass es nicht richtig wäre, diese Personengruppen immer nur als Opfer zu stilisieren, denn sie wären meist auch die Täter. In seinem Studiengang hätten „alle Homosexuellen“ Heterosexuelle gestalked, und dieses Verhalten könne er auch erklären: Aids-Medikamente würden nämlich Borderline verursachen, und da ja alle Schwulen Aids-Medikamente nehmen, wären das eben alles Narzissten. Und man dürfe auch nicht vergessen, Schwule würden nicht auf Schwule stehen, sondern auf Männer, und Lesben auf Frauen, nicht auf Lesben.
Ich war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos und durchlief innerhalb weniger Minuten mehrere Gefühlslagen. Nachdem ich erst dachte, ich hätte mich sicher verhört oder etwas falsch verstanden, wurde ich dann immer ungläubiger und saß irgendwann einfach völlig fassungslos da und habe gewartet, dass endlich jemand interveniert- wenn niemand der Studierenden, dann doch wenigstens die Dozentin. Aber es passierte- nichts. Ein paar wenige Richtigstellungen am Ende des Referates, dann kam der Übergang zum nächsten Vortrag. Ein Übergang, den alle mühelos zu bewerkstelligen schienen. Ich nicht. Homophobe Verschwörungstheorien in einem Master-Seminar und niemand sagt etwas dagegen?
Danach begann es in mir zu arbeiten. Ich sprach die Dozentin nochmal an, ob der Vorfall nun so stehengelassen würde. Daraufhin bot sie mir an, etwas vorzubereiten und in der nächsten Seminarsitzung vorzustellen. Das war immerhin etwas, aber nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich fühlte mich in meiner Wahrnehmung nicht ernst genommen. Wieder einmal war ich die hysterische Studentin, die alles problematisiert und dramatisiert. Die, die immer das nervige generische Femininum benutzt und für die alle Männer unter Generalverdacht stehen. Die Feministin eben.
Und dann habe ich das getan, was ich immer mache, wenn ich aufgebracht, wütend, durcheinander, alles zusammen bin: Ich habe geschrieben. Einen Text, den ich eigentlich für mich behalten wollte, weil er doch so persönlich geworden ist, dass ich ihn nicht mit dem gesamten Seminar teilen wollte- einem großen Seminar, in dem ich mit kaum einer Kommilitonin bisher ein Wort gewechselt hatte. Aber dann reifte in mir der Entschluss, gerade diesen Text vorzulesen. Weil persönliche Texte eben nochmal ganz anders aufrütteln und berühren als Statistiken.
Ich hatte Angst vor dieser Seminarsitzung, große Angst. Bereits vier Nächte zuvor konnte ich nicht mehr schlafen, malte mir aus, was alles passieren könnte und ob ich bereit wäre, im schlimmsten Fall das Seminar nicht weiter zu besuchen. Ich verabredete mit meiner Mutter, dass ich mit ihr telefoniere, bis ich nach dem Seminar (einer Abendveranstaltung) am Auto angekommen bin und es von innen verriegelt habe. Und als dann besagter Tag da war, wurden die Zweifel immer größer. Wofür ich das eigentlich mache und ob es das wert ist.
Die Zweifel nahmen noch mehr zu, als ich zuvor noch einmal mit der Dozentin sprach, um mit ihr das Vorgehen abzustimmen. Sie fand es nämlich „schwierig“, dass ich etwas gegen die Äußerungen unternehmen wollte, denn der Kommilitone hätte gegen kein Gesetz verstoßen und es wäre sein Recht, seine Meinung frei zu äußern. In der Uni gäbe es sicher auch Menschen mit rassistischer oder antisemitischer Weltanschauung. Und ich würde seinen Thesen nochmal eine Plattform geben, wenn ich sie erneut aufgreife (was mir ziemlich grotesk erschien in Anbetracht der Tatsache, dass er in der Seminarsitzung davor eine uneingeschränkte Plattform bekam- ganz davon abgesehen, dass ich von der Ignorieren-Strategie nichts halte, siehe den Umgang mit der AfD. Ignorieren können immer nur die, die nicht betroffen sind.).
Ich habe meinen Text trotzdem vorgelesen. Ich war aufmüpfig. Und bin belohnt worden. Viele sind nach dem Seminar noch einmal zu mir gekommen, um sich für meinen Mut zu bedanken. Ich, die Einzelgängerin, die in drei Jahren Studium kaum jemanden kennengelernt hat, stand plötzlich inmitten einer großen Gruppe. Ein bisschen so, als wäre ich die Heldin des Seminars. Und vielleicht war ich das ja auch an diesem Tag- zumindest für mich selbst, und das ist ohnehin das großartigste Gefühl.
Es war das erste Mal, dass ich einen solchen Schritt gegangen bin. Nun hatte ich das (unverhoffte) Glück, viel Rückendeckung zu bekommen. Ich weiß von anderen radikalen Feministinnen, dass das bei weitem nicht immer so ist. Und trotzdem würde ich es immer wieder tun. Ich möchte mich weiter im Spiegel anschauen können. Ich möchte später meinen Kindern erzählen, wie ich damals gegen diese Ungerechtigkeit aufgestanden bin. Ich möchte durchhalten, als Feministin im Patriarchat, mit all den Anstrengungen und Sanktionen, mit denen das verbunden ist.
Vor zwei Jahren noch hätte ich mich nie und nimmer getraut, mich allein gegen eine (scheinbare) Gruppe zu stellen. Was den Unterschied macht, ist, dass ich inzwischen eine radikale Feministin bin. Ich ecke ständig an. Wenn ich reine Frauenräume fordere, wenn ich auf Mansplaining hinweise oder wenn ich von meiner prostitutionskritischen Bachelorarbeit erzähle. Mir hat beim Durchstehen – wie so oft – Mary Daly sehr geholfen, wenn sie sagt:
Ich weiß, daß Feministin zu sein, von einem tiefen, furchteinflößenden Gefühl des Andersseins vom Patriarchat begleitet sein muß. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag an der Grenze arbeiten. Aber ich gehöre nicht dazu. […] Frauen sind das Andere im Patriarchat. Ich möchte anders sein, ich möchte keine patriarchalische Frau sein.[1]
Es braucht Leute, die aufstehen. Am besten Frauen. Mir ist in diesem Kontext zum ersten Mal richtig bewusst geworden, warum neben den mir so wichtigen reinen Frauen- und Lesbenräumen unter bestimmten Umständen auch Bündnisse wichtig sein können. Mir als radikaler, separatistischer Lesbe, die um die Kämpfe um Sichtbarkeit und Anerkennung in der lesbisch-schwulen „Community“ (wenn man denn von dieser sprechen kann) weiß (ganz abgesehen vom unsäglichen Umgang mit Frauen und Lesben in weiten Teilen der Trans-Debatte), wird der Part der inkludierenden Haltung sonst selten bis nie zuteil. Aber in diesem Moment war für mich sonnenklar, dass ich für die Rechte von all den genannten Gruppen aufstehen muss. In diesem Moment wurden wir alle Opfer patriarchaler Mythen. Opfer eines Systems, das uns sanktioniert und uns keine Stimme gibt, uns Frauen am allerwenigsten.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Männer vom Patriarchat profitieren, alle Männer. Deshalb ist es ja auch so schwierig für Lesben, unter Schwulen Gehör zu bekommen und eigene Interessen durchzusetzen. Ein Abbild des Patriarchats, das sich auch zwischen Lesben und Schwulen zementiert, denn Schwule und Lesben sind eben- Männer und Frauen. Und trotzdem gibt es Homophobie, gegen Lesben und auch gegen Schwule (wenn auch in sehr unterschiedlicher Form). Gegen diese bin ich aufgestanden, aber nicht nur aus Eigeninteresse. Ich wünsche mir (auch wenn dieser Wunsch vielleicht utopisch ist), dass wir trotz unserer Differenzen füreinander einstehen, wenn wir gemeinsam bedroht oder diskriminiert werden- denn von einem Großteil der Gesellschaft werden wir (leider) als eine homogene Gruppe angesehen, dominiert natürlich von Männern. Wenn wir einen Weg finden, wie wir eigene separatistische (Denk-) Räume, aber auch Bündnisse an den Stellen, wo sie sinnvoll sind, zusammenbringen können, könnte das möglicherweise die Lösung vieler Probleme sein, von denen nicht nur Lesben, sondern auch andere Frauen profitieren würden.
Vor allem aber möchte ich alle anderen Frauen, Lesben, Radfems mit meiner Geschichte ermutigen, Kämpfe zu führen, mutig zu sein, für sich selbst und andere einzustehen. Das können viele nicht, weil sie berechtigte Angst vor existenzbedrohenden Sanktionen haben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns verbünden und solidarisieren. Vielleicht ist es unsere Lebensaufgabe, aufmüpfig zu sein, um unsere Heldinnen zu werden.
Dies ist der Text, den ich für das Seminar geschrieben habe
„Lesbische Sichtbarkeit“ lautet die Maxime eines großen Diskurses, der sich gerade durch die lesbische Community zieht. Die Berliner Journalistin Stephanie Kuhnen hält gemeinsam mit vielen anderen Autorinnen in ihrem Sammelband „Lesben Raus“ ein Plädoyer für eben diese Sichtbarkeit. Außerdem fand in diesem Jahr die erste europäische Lesbenkonferenz statt, und durch eine Unterschriftenaktion könnte es erstmals möglich werden, dass lesbischen Opfern im Nationalsozialismus offiziell gedacht wird.
Es tut sich also etwas, in der Szene und auch in unserer Gesellschaft. Es wächst eine Generation heran, die mit ihrer sexuellen Orientierung offen umgehen kann, die dazu ermuntert wird, sich auszuprobieren und den eigenen Lebensentwurf zu finden- ganz diskriminierungs- und sanktionsfrei.
Je nachdem, in welcher Blase man lebt, glaubt man so etwas. Die Hochschule war für mich lange Zeit so eine Blase. Aber die Hochschule ist eben auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft, auch wenn sich in ihr nicht alle gesellschaftlichen Strömungen wiederfinden. Insofern ist es eigentlich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass es auch in der Uni Homphobie gibt, genauso wie Sexismus, Rassismus und viele andere –ismen, von denen wir uns alle nicht ganz frei machen können.
Was letzte Woche in diesem Seminar passiert ist, hat aber noch einmal eine andere Qualität. Ein Student bekommt in einem Master-Seminar für ErziehungswissenschaftlerInnen und SozialpädagogInnen, für Menschen also, die bald eine immense gesellschaftliche Verantwortung innehaben werden, eine Plattform, um in einer völlig ausufernden „Anmerkung“ zu einer Statistik Thesen zu verbreiten, die an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kaum zu übertreffen sind, und niemand stoppt ihn dabei. Niemand interveniert, unterbricht, sagt ihm ins Gesicht, dass seine Überzeugung diskriminierend ist. Dass die Grundlage pädagogischer Handlungskompetenz darin besteht, die Lebensentwürfe anderer Menschen zu akzeptieren, auch wenn sie nicht den eigenen entsprechen. Dass er solche Aussagen nicht in einem Seminar tätigen darf, in einem Seminar über sexualisierte Gewalt noch dazu, denn in dem Moment, in dem er dies tut, ist es nicht mehr seine Privatmeinung, sondern geschieht in einem öffentlichen Kontext, in einem Bildungskontext. Es muss Konsequenzen haben, wenn jemand so etwas tut. Ganz davon abgesehen, dass ein solches Vorgehen nebenbei auch völlig unwissenschaftlich ist und allein deshalb in kein Seminar gehört.
Ich war eine davon. Eine der Studentinnen, die im Seminar saß und nichts gesagt hat. Die sich still alles angehört hat, immer größere Augen bekommen hat, irgendwann zitternd und mit Herzrasen dasaß und die ganze Zeit gehofft hat, dass man ihr nicht ansieht, dass der Mann, der dort vorne redet, über sie spricht. Über sie, ihre Freundinnen und Freunde.
In dem Moment habe ich es nicht geschafft, meine Stimme zu erheben. Aber jetzt, jetzt bin ich hier und spreche.
Ich habe es in der kurzen Zeit nicht geschafft, etliche Bücher zu wälzen, um die Aussagen des Kommilitonen fundiert zu widerlegen. Allerdings bin ich mir sicher, dass die meisten von euch ohnehin wissen, dass man Borderline nicht von Aids-Medikamenten bekommt, dass BorderlinerInnen keine narzisstischen Monster sind, die alle gleichgeschlechtlichen Menschen anfallen und dass nicht alle Schwulen Aids haben. Und wenn ihr es nicht wisst, traue ich euch zu, dies selbstständig zu recherchieren.
Worum es mir heute geht, ist, aufzustehen. Für die anderen, die letzte Woche hier in diesem Raum saßen und denen es genauso ging wie mir. Für diejenigen, die lesbisch, schwul, bi, trans oder inter sind. Für diejenigen, die Borderline haben. Für diejenigen, die Aids-Medikamente nehmen. Für diejenigen, auf die nichts davon zutrifft, die aber empört und solidarisch sind. Wenn nur einzelne von uns aufstehen, erfordert es unglaublich viel Mut und Kraft, aber wenn wir viele sind, wird es für jede von uns einfacher. Dafür sind Bündnisse da.
Nun stehe ich hier, ganz sichtbar, und ich weiß beim Schreiben dieses Textes noch nicht, wie es mir dabei ergehen wird. Was ich euch aber abschließend mitgeben möchte, ist die Ermunterung, gegen Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und Gewalt aufzustehen, sowie die Gewissheit, dass ihr nicht allein seid. Und ein Zitat von Audre Lorde:
Im Namen des Schweigens zeichnet sich für jede von uns das Gesicht ihrer eigenen Angst ab – Angst vor Verachtung, vor Zensur oder irgendwelchen Urteilen oder vor Erkenntnissen, Angst vor Herausforderung, Angst vor Vernichtung. Mehr als alles jedoch […] fürchten wir die Sichtbarkeit, ohne die wir nicht wahrhaftig leben können. […] Doch diese Sichtbarkeit, die uns höchst verletzlich macht, ist auch die Quelle unserer größten Kraft.
[1] Aus: Mary Daly “Ich gehöre nicht dazu…” Ein Interview. Zweitabdruck in dem Band “Utopos – Kein Ort. Mary Daly`s Patriarchatskritik und feministische Politik.” – Marlies Fröse (Hg.), Bielefeld 1988 S 157-161).


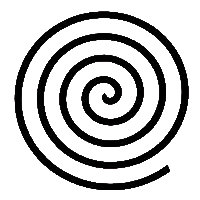

Vielen Dank für Dein Engagement! Ja, wenn uns etwas nicht passt, müssen wir es kundtun. Dies mag auf dem ersten Blick nicht immer angenehm sein, doch es ist wesentlich besser, als diesen Impuls zu unterdrücken. So geht es mir persönlich zumindest.
Danke!
Meine Heldin bist Du auch 🙂
Du wunderbare, tapfere, kluge, starke junge Frau.
Ich verbeuge mich vor dir!
Gerade weil ich weiß wieviel Mut und Kraft dich dieser Brief,
dieses “in die Öffentlichkeit gehen” gekostet hat.
Mir hat dein Satz gefallen das du deine eigene Heldin geworden bist.
Mit Recht und Stolz kannst du das jetzt behaupten.
Ich bin stolz eine so mutige und intelligente Frau auf “unserer”, der feministischen Seite, zu wissen.
Wieviele ältere trauen sich das nicht; schauen zu wenn eine Schwester angefeindet und kleingemacht wird. Schlimmer noch das sie wissen was sie da tun, und es nur tun um ihre Ruhe zu haben. Die, wie deine Dozentin, patriarchalische Frauen sind.
Du schaffst das schon in jungen Jahren, noch mehr Grund wirklich stolz zu sein. Hut ab! und Danke für deinen Einsatz.
Bravo! Gratulationen zu Deinem Mut. Du wirst hoffentlich stolz sein auf Dich! Na klar sind radikale Feministinnen oft einsam. Unerhört und ungehört. Deshalb sind solche Klarstellungen soooo wichtig. Ob’s in diesen Zeiten etwas nützt weiss man/frau leider nicht. Aber wichtig sind solche Klarstellungen trotzdem. Immer und immer wieder.
Kann man dich, die Gastbeiträgerin, irgendwo kennenlernen? Betreibst du einen Blog? Du bist sehr eloquent und intelligent. Ich würde gerne mehr von dir lesen. Ich freue mich sehr über radikalfeministische Gleichgesinnte.
Wichtiger und starker Text! Danke für deinen Mut!
Klasse Text, ich bewundere dich für deine Kraft, ihn vor dem gesamten Seminar vorzutragen!
Solche oder ähnliche Situationen gibt es an den Unis leider immer wieder. Wer nicht den Mut hat, selbst solche Vortäge zu halten (oder wem es nicht möglich ist, bspw. weil nicht ein Kommilitone die problematischen Thesen verbreitet hat, sondern der Dozent selbst), kann sich übrigens auch an die Gleichstellungsbeauftragte der Uni und/oder die studentische Gleichstellungsbeauftragte wenden.