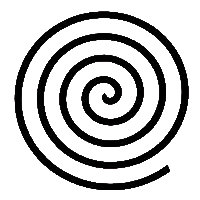Meine Psychotherapie-Geschichte ist lang. Sie beginnt vor etwa fünf Jahren, damals war ich 17 und stand kurz vor meinem Abitur.
Zu dieser Zeit brach etwas mit voller Wucht aus mir heraus, was ich all die Jahre mit meinem Lächeln überspielen konnte. Mit einem Mal wurde ich schlecht in der Schule, konnte nicht mehr am Unterricht teilnehmen, hatte Panikattacken und dissoziative Zustände. Meine LehrerInnen sahen Handlungsbedarf und informierten meine Eltern. So landete ich bei meiner ersten Therapeutin, es folgten rasch weitere. Alle gingen davon aus, dass ich ihnen sofort vertrauen und munter meine Geschichte erzählen würde. Ich fühlte mich völlig überfordert und bloßgestellt, konnte auf die Fragen nicht antworten und brach eine Therapie nach der anderen ab. Eine Therapeutin ist mir dabei noch besonders im Gedächtnis geblieben: Sie holte in der zweiten Therapiesitzung ihren Ehemann (ebenfalls Therapeut) dazu, weil sie von ihm eine Einschätzung zu meinem Zustand hören wollte. Ich glaube, heute bin ich mit meinem Wissen und Gefühl für Grenzüberschreitungen noch fassungsloser darüber, als ich es damals war.
Immer wieder wurde mir außerdem vermittelt, ich käme nicht um einen stationären Klinikaufenthalt umhin. Für mich kam das nie infrage. Eine Notfall-Nacht auf einer geschlossenen Station reichte mir. Man ist rund um die Uhr auf engstem Raum mit fremden Menschen zusammen, die allesamt vor dem Nichts stehen, und kann sich nicht aus dem Weg gehen. Man hat keine Privatsphäre, selbst die Badezimmer können jederzeit vom Pflegepersonal geöffnet werden. Der einzige Ort, der einem außer dem eigenen Zimmer bleibt, ist das Raucherzimmer, in dem man sich dann mit zwanzig Mitpatienten darüber austauschen kann, auf welche Weise man jeweils versucht hat, sich umzubringen.