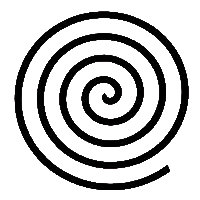Wir erinnern uns: nachdem am 21. Dezember 2013 eine Demonstration zum Erhalt des linken Kulturzentrums Rote Flora im Hamburger Stadtteil Sternschanze völlig aus dem Ruder gelaufen war, und es im Anschluss daran wiederholt zu Auseinandersetzungen im Stadtteil kam, verhängte die Hamburger Polizei am 4. Januar 2014 Januar ein weiträumiges Gefahrengebiet. Schuld waren wie immer die Linken. Alles, was nur im entferntesten im Verdacht stand, links zu sein oder mit links zu sympathisieren, wurde daraufhin kontrolliert, und in Zweifelsfall erst einmal in Gewahrsam genommen. So auch mehr als 50 Personen, die sich am 5. Januar 2014 verabredet hatten, um vor Ort gegen den Ausnahmezustand zu protestieren. Sie wurden eingekesselt, Personalien festgestellt und 44 Personen über Nacht auf der Polizeiwache festgehalten. Das war rechtswidrig! Entschied das Verwaltungsgericht Hamburg Ende vergangener Woche.
Nun ist es aber selbst im Gefahrengebiet so, dass alle Anwohnenden das Recht haben, ein Transparent zu malen, und damit auf die Straße zu gehen, wie Anwalt Andreas Beuth laut taz Hamburg erkäuterte. Wenn sich dann aus der Nachbarschaft spontan andere dazu gesellen, sei es deren gutes Recht, so der Strafverteidiger.
Beuths Kollegin Ingrid Witte-Rohde sah ebenfalls nicht die Ruhe im Gefahrengebiet gestört, sondern in der „Verhinderung der Spontandemo eine grundrechtswidrige Beschneidung des Rechts auf Versammlungsfreiheit“. Eine Sicht, der sich das Gericht anschloss. 17 der Betroffenen hatten gegen den Polizeikessel und die Ingewahrsamnahme geklagt. Nachdem sie nun Recht bekommen haben, wollen Beuth, Witte-Rohde vor Gericht eine Entschädigung für ihre Mandantschaft erstreiten. Die Gegenseite wird vermutlich darauf verzichten, den Rechtsweg gegen dieses Urteil zu beschreiten. Zumindest gaben sich die laut taz die „Polizei-AnwältInnen schuldbewusst“. Ein denkwürdiges Ereignis
Am 21. Dezember 2013 wurde ordentlich was geboten am im Hamburger Schanzenviertel bei der internationalen Demo „Für den Erhalt der Roten Flora, für das Bleiberecht der Lampedusa Flüchtlinge und den Erhalt der Esso-Häuser auf St. Pauli“. Die Medien überschlugen sich mit Bildern von gezündeten Feuerwerkskörpern, brennenden Autos und Steine werfenden DemonstrantInnen. Eine Debatte über Sinn und Unsinn von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele entbrannte anschließend, in den Medien, in Internet-Netzwerken und auch am Stammtisch im Viertel. Nicht nur konservative PolitikerInnen taten sich mit Forderungen nach harten Sanktionen hervor.
Über die Ursachen sprach indes kaum jemand: weder vom aufgeheizten politischen Klima in der Hansestadt, noch den Provokationen seitens des Senats und der Polizei im Vorfeld, noch über den massiven Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray und die mehrfache Einkesselung der Demonstrierenden durch die Staatsmacht während der Demo – geschweige denn davon, dass neben dem ganzen Trubel im Schanzenviertel und St. Pauli in der Innenstadt knapp 1.000 Menschen völlig friedlich für das Bleiberecht nicht nur der Lampedusa-Flüchtlinge demonstrierten.
120 verletzte PolizeibeamtInnen und ca. 500 verletzte Demonstrierende – das ist nicht NICHTS. Und spricht für eine hohe Gewaltbereitschaft, allerdings auf beiden Seiten. Die Debatte über die Eskalation, die der Demo folgte, mutet an wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Doch eigentlich geht es nicht um die Gewalt an sich, sondern um die politischen Verhältnisse, die dieses Potential zum Ausbruch brachten.
Ursachen der Eskalation
Da wäre zum einen der monatelange Kampf der Lampedusa-Flüchtlinge für ein Bleiberecht, nicht nur für sich, sondern für alle Bedürftigen. Die Gruppe erfuhr eine unbeschreibliche Solidarität seitens der Bevölkerung, nicht nur im Stadtteil St. Pauli. Selbst die CDU im Bezirk Altona solidarisierte sich mit den Gestrandeten, nur der Senat, allen voran der Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), blieb und bleibt hart. Bleiben sollen die Flüchtlinge sowieso nicht, und selbst als die Bezirksversammlung Altona im Herbst 2013 einstimmig beschloss, den Asyl gewährenden Kirchen zu gestatten, für die Wintermonate beheizbare Container für die Männer aufzustellen, versuchte Scholz dieses mit aller Macht zu verhindern. Das ruft nicht nur Kopfschütteln hervor, sondern Wut.
Dann wären da die Esso-Häuser, ein Wohnblock an der Reeperbahn, der von häufig wechselnden Vermietern regelrecht verfallen gelassen wurde, um mit dem Grundstück spekulieren zu können, und für einen ordentlichen Profit Luxuswohnungen an der Stelle zu errichten. Genau eine Woche vor der Flora-Demo wurde der Wohnblock in einer Nacht- und Nebelaktion gewaltsam geräumt, angeblich wegen der hohen Einsturzgefahr, und die BewohnerInnen hockten zum Teil Weihnachten in einer Turnhalle und konnten sich über wahrlich besinnliche Festtage freuen.
Dann wäre da Klausmartin Kretschmer, ein Kiez-Geschäftsmann, der sich gern als „Kultur-Investor“ sieht, dessen Vorstellungen von Kultur aber in keiner Weise mit denen der RotfloristInnen und auch nicht dem größten Teil der BewohnerInnen des Stadtteils konform gehen. Der 2001 dem damaligen Senat die Flora abkaufte und aus dem autonomen Stadtteilprojekt „Rote Flora“ ein profitables Eventcenter zu machen gedenkt, zu diesem Behufe gegen den amtlichen Bebauungsplan klagte und der Roten Flora kurz vor der lange angekündigten Demo eine Frist zur Räumung bis genau einen Tag vor eben dieser setzte.
Dann wäre da die Polizei, die es für angemessen hielt, am besagten Samstag die gesamte Innenstadt zum Gefahrengebiet zu erklären, und somit die Möglichkeit schuf, beliebig Verweise zu erteilen und verdachtsunabhängige Personenkontrollen oder auch Ingewahrsamnahmen durchführen zu können, sprich demokratische Grundrechte mal kurz aushebelte.
Dann wäre da noch einmal die Polizei, die das gesamte Militärarsenal am Tag vor der Demo auf dem Heiliggeistfeld auffahren ließ, da wo bis kurz vorher noch „das größte Volksfest im Norden“, der Hamburger Dom, stattfand. Eine gewollte Provokation, die natürlich den Hasspegel seitens der DemonstrantInnen steigen ließ, und dafür sorgte, dass selbige sich ihrerseits für den Nahkampf rüsteten. Jedenfalls ein Teil der Demo-TeilnehmerInnen.
Da wären dann noch die Medien, die schon in der Woche vor der Demo „Krawalle in der Schanze“ abfeierten.
Das alles gepaart mit dem offensichtlichen Willen der Polizeiführung, die Demo unter allen Umständen zu unterbinden, führte zu dem bekannten Ergebnis.
Wer sich die entsprechenden Berichte im TV ansah, musste zu der Überzeugung gelangen, im Schanzenviertel und in St. Pauli tobe der Bürgerkrieg, bei dem niemand – insbesondere PolizeibeamtInnen – seines oder ihres Lebens sicher sei, während zerstört, geraubt und gebrandschatzt wurde, was das Zeug hält.
Unter den 7.300 Teilnehmenden will die Hamburger Polizei 4.700 gewaltbereite TeilnehmerInnen ausgemacht haben. Woher diese Erkenntnis kommt, das sagte die Polizeipressestelle nicht. Musste sie auch nicht, weil schlicht niemand danach fragte. Ebenso wenig wurde hinterfragt, warum eine Demo zu früh gestartet sein soll, wenn sie für 14h angemeldet war und der Zug sich um kurz nach 15h schließlich und endlich in Bewegung setzte?! Auch die Behauptung der Polizei, die BeamtInnen seien angegriffen worden, weshalb der Zug gestoppt worden sei, wurde nicht angezweifelt. Dabei belegen nicht nur Videos auf YouTube, dass der Zug völlig friedlich losmarschierte und dann von den BeamtInnen mit Schlagstöcken gestoppt wurde. Das bezeugt u.a. auch der ARD-Reporter Patrick Gensing, der sozusagen an vorderster Front dabei war. Dass damit die unbestreitbar vorhandene Gewaltbereitschaft seitens eines Teils der Demo-TeilnehmerInnen angestachelt wurde, sollte nicht wirklich verwundern.
Dünne Beweislage für die Polizei
Da offensichtlich selbst Springer-Reporter nachrechnen können, dass eine Demo nicht zu früh gestartet sein kann, wenn sie für 14 Uhr angemeldet war und sich um kurz nach 15 Uhr schlussendlich in Bewegung setzte, und da im Internet zu Hauf Videos, Augenzeugenberichte, z. T. von bürgerlichen JournalistInnen, etc. auftauchten, die belegten, dass aus der Demo bis zu deren gewaltsamen Abbruch seitens der Polizei keine Gewalt ausgegangen sei, war die Beweislage für die Staatsmacht recht dünn. Das Szenario, das am 21.12.2013 nach 15 Uhr folgte, der stundenlange Kessel vor der Roten Flora, die Gewaltexzesse, bei denen Glasscheiben zu Bruch gingen, Autos zerstört wurden, unbeteiligte Anwohnende sich bedroht fühlten, und bei dem knapp 700 Menschen zu Schaden kamen, ließ sich nicht lange mit dem hohen Gewaltpotential seitens der Demonstrierenden erklären. Sehr schnell wurde klar, dass die harte und unbesonnene Strategie seitens der Polizeiführung entscheidend zur Eskalation beigetragen hat. Auch wenn in den Medien zunächst nur die üblichen Krawallberichte zu sehen waren, gerieten Polizei und Senat zunehmend in Erklärungsnot.
Doch dann gab es einen zweiten Angriff auf die Davidwache, am 28. Dezember 2013, bei dem nicht nur Scheiben und Autos zu Bruch gingen, sondern ein Polizeibeamter schwer verletzt wurde. Angeblich skandierten 30 bis 40 dunkel gekleidete, zum Teil (u.a. mit St.Pauli-Schals) vermummte Personen in Sprechchören: „St.Pauli – Scheißbullen – Habt Ihr immer noch nicht genug!“ Als Polizeibeamte daraufhin aus der Davidwache herauskamen, wurden sie an der Ecke Reeperbahn/Davidstraße aus der Personengruppe heraus gezielt und unvermittelt mit Stein- und Flaschenwürfen angegriffen.
So war es jedenfalls in der ersten Pressemitteilung der Hamburger Polizei zu lesen, die Medien bundesweit zitiert wurde. Spontan folgten Solidaritätserklärungen mit den BeamtInnen der Davidwache, Soligruppen wurden in sozialen Netzwerken gegründet und eine Demonstration gegen Gewalt gegen die Polizei wurde durchgeführt, die sich ebenfalls großer Unterstützung aus der Bevölkerung erfreute.
Gestärkt durch so viel Solidarität in der Bevölkerung, richtete die Polizeiführung in Teilen von Hamburg-Altona, St. Pauli und der Sternschanze das weiträumige Gefahrengebiet ein, das immerhin die Größe einer Kleinstadt hatte. Gültig ab Samstag, 4.1.2014 6 Uhr, und von unbegrenzter Dauer. Über ein Gebiet, mitten in einer Millionenstadt, in dem zehntausende Menschen leben und sich jedes Wochenende weitere zehntausende TouristInnen einfinden, wurde auf zunächst unbestimmte Zeit der Ausnahmezustand verhängt. OHNE dass ein Parlament darüber befunden hätte.
Konkret heißt Gefahrengebiet: Die Polizei legt eigenständig das Gebiet und die Dauer fest, in der verdachtsunabhängige Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt, Platzverweise ausgesprochen oder auch Ingewahrsamnahmen durchgeführt werden können. Sie legt eigenständig fest, wie oft und mit wie viel Personal diese Kontrollen durchgeführt werden. Das alles, um „sehr deutlich (zu) machen, dass die Polizei Hamburg alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen wird, um Leib und Leben ihrer Beamten zu schützen“, wie sie in einer Presseerklärung vom 3.1.2014 mitteilte. Seit dem 4.1.2014 6 Uhr Ortszeit wurde demnach also zurückrandaliert.
Die Polizei fühlte sich bedroht, und im Vertrauen auf die Unterstützung seitens der Bevölkerung in den in Frage kommenden Stadtteilen wurde deshalb mal eben die Demokratie außer Kraft gesetzt. DIE LINKE ließ verlautbaren, prüfen zu lassen, inwieweit das verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist, wie die innenpolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion, Christiane Schneider, in einer Presseerklärung mitteilte. Das Gefahrengebiet sei „verfassungslos“, kommentierte jemand in einem Forum in einem sozialen Netzwerk im Internet.
Der Angriff auf die Davidwache vom 28.12.2013 erwies sich – vorsichtig formuliert – als Übertreibung. Die Polizeipressestelle musste zugeben, dass die anfängliche Darstellung nicht den Tatsachen entsprach. Das alleine hätte ja an sich schon reichen müssen, um das Gefahrengebiet schnellstmöglich wieder aufzuheben. Aber nein, die Hamburger Staatsmacht musste sich erst so richtig zum Narren machen und allen Medien täglich eine neue Steilvorlage geben, das Gefahrengebiet bundesweit zur Lachnummer zu machen.
Schills Vermächtnis
So richtig ernst nahm es außer der US-Botschaft in Berlin schon bald niemand mehr. Die mahnte indes ihre Landsleute offiziell bei einem Hamburg-Besuch zur Vorsicht, so dass dort ansässige Geschäftsleute um Einbußen bei ihren Einnahmen fürchteten. Verschiedene Medien konnten sich bissige Kommentare nicht verkneifen, vor allem nachdem eine Klobürste es als subversives Element bis in die Tagesschau schaffte und so zum Symbol des Widerstands wurde. Schlussendlich ruderte die Polizei nun nach 9 Tagen zurück, allerdings nicht ohne die Aufhebung als Erfolg der polizeilichen Maßnahme zu feiern: „Diese positive Entwicklung setzte sich in den vergangenen Tagen in den modifizierten Gefahrengebieten fort … Damit sind die mit der Einrichtung der Gefahrengebiete verfolgten Ziele erfolgreich erfüllt worden“, hieß es in der Pressemitteilung der Polizei.
Die Aufhebung des Gefahrengebietes war ganz sicher ein Erfolg der vielfältigen Proteste, erfolgte allerdings reichlich spät. Das schrieb auch die Frankfurter Rundschau. Abgesehen davon ist es jederzeit möglich, aus der „Fortsetzung der Präsenzmaßnahmen“ wieder ein Gefahrengebiet zu machen. Denn die Möglichkeit dazu hat die Hamburger Polizei nach wie vor. Sie wurde ihr 2005 vom damaligen CDU-Schill-Senat mit der Änderung des Polizeigesetzes übertragen.
Seit Juni 2005 hat die Polizei das Recht, aufgrund ihrer „Lageerkenntnisse“ sogenannte „Gefahrengebiete“ zu definieren, in denen sie „Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen“ darf (§ 4 Abs. 2 PolDVG). Seit in Kraft treten dieses Gesetzes ist die Polizei ermächtigt, nach eigenem Gutdünken Gefahrengebiete zu errichten, OHNE dass ein Parlament oder ein Gericht dem zustimmen muss. Nach dem Gefahrengebiet ist vor dem Gefahrengebiet – jedenfalls so lange, bis das Polizeigesetz entsprechend geändert wird.
In der Zeit vom 1.7.2005 bis 31.7.2013 gab es laut der Bürgerschaftsfraktion der LINKEN in den seither in Hamburg errichteten Gefahrengebieten 54.967 Identitätsfeststellungen, 12.499 Inaugenscheinnahme mitgeführter Sachen (Durchsuchungen), 13.793 Platzverweise, 3.858 Aufenthaltsverbote, 2.464 Ingewahrsamnahmen, 6.197 Ermittlungsverfahren. Nicht bekannt ist allerdings, wie viele davon zu einem Verfahren oder gar einer Verurteilung führten.
Viel Wind um … NICHTS
Auch nach der Aufhebung des Gefahrengebietes blieben viele Fragen offen, z. B. die nach den Vorkommnissen bei der Davidwache am 28.12.2013 oder auch inwieweit die Polizeiführung in die Entscheidung, das Gefahrengebiet zu errichten, eingebunden war. Außerdem wäre es interessant zu erfahren, warum die Hamburger Grün-Alternative-Liste (GAL) ihre Amtsperiode als Regierungspartei mit der CDU nicht nutzte, um die Änderung des Polizeigesetzes, insbesondere die Streichung des § 4 Abs. 2 PolDVG, auf den Weg zu bringen, um eine solch weitreichende Entscheidung wieder unter die demokratische Kontrolle des Parlaments und der Justiz zu bringen.
Durch die Proteste gegen das Gefahrengebiet wurde zwar erreicht, dass dieses wieder aufgehoben wurde. Allerdings gerieten so die Gründe, die zu der Demo am 21. Dezember 2013 geführt hatten – die Räumung der Esso-Häuser und die Situation von Flüchtlingen in der Hansestadt – mehr oder weniger ins Hintertreffen. Die Klobürste ist zwar nach wie vor ein running gag von Flensburg bis zum Bodensee, doch die Esso-Häuser sind dem Erdboden gleich gemacht, und die Lampedusa-Flüchtlinge sitzen nach wie vor auf der Straße und kämpfen ums nackte Überleben.
Birgit Gärtner