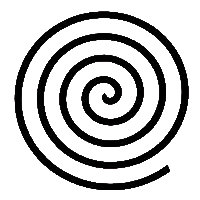Vor einiger Zeit starb meine Mutter. Wir hatten ein „schwieriges“ Verhältnis, der Kontakt war seit Jahren abgebrochen. Das hat u. a. mit meiner nicht so prickelnden Kindheit und Jugend zu tun (ein Teilaspekt dieses Lebens beschreibe ich auch in diesem Artikel).
Die Gesellschaft und die (Bio-)Familie und ihre Bekannte fordern von Menschen, hier: von einer Frau, deren Mutter stirbt, eine konventionelle Trauer[TM]; dass mir das nicht möglich ist und war, ist und bleibt für sie unverständlich und teilweise nicht tolerabel.
Dabei sind die Reaktion/en, die der Tod einer Person auslöst, die Mitverursacherin einer Traumafolgestörung ist, hochgradig komplex (eine dissoziative Identitätsstruktur macht das Ganze noch einmal auf einer anderen Ebene schwierig).
Widersprüchlich sind die Gefühle diesen Menschen gegenüber, die von uns rein objektiv gehasst werden dürften. Aber da ist das kleine Mädchen, dass die „beste Mama der Welt“ hat, da ist die Jugendliche, die ihr – würde sie der Mutter begegnen – an die Gurgel gehen würde (und das meine ich nicht im übertragenem Sinne), da ist die andere Jugendliche, die all dieses Leid auf sich genommen hat, weil sie glaubt, dass diese Behandlung aus ihr einen besseren Menschen macht; dass es notwendig war und ist, gedemütigt zu werden. Und am Ende der Dissoziationskette sind die, die die Schmerzen ausgehalten haben, die die anderen Innenanteile zuvor nicht mehr aushielten, und diese Schmerzen haben sie heute noch.