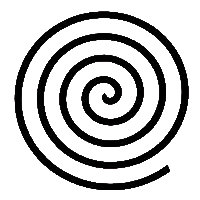Gleise Bahnhof Köln-Deutz
Anmerkung: Dieser Text ist stellenweise zynisch. Das ist nicht unbedingt ein “literarisches Mittel”, sondern in erster Linie eine Überlebensstrategie.
Mein Rentenversicherungsträger hat mir kürzlich mitgeteilt, dass ich weder arbeits- noch rehabilitationsfähig bin. In der Konsequenz heißt das, dass er mich in Rente (auf Zeit) schickt. Das gibt Mitmenschen Anlass mir mitzuteilen, dass ich entweder faul bin oder mich nicht so anstellen soll oder zu sagen: „Ich schaffe es schließlich auch.“
In meinem Leben gibt es im Moment ein Tabu, einen Teil Alltag, den ich am liebsten immer und überall verschweigen möchte: Ich lohn-arbeite nicht, denn ich bin nur begrenzt gesellschaftlich verwertbar arbeitsfähig. Als ich vor ca. einem Jahr an einer schweren Depression erkrankte und sich zeitgleich die Symptomatik meiner Posttraumatischen Belastungsstörung (in der Ausprägung einer Dissoziativen Identitätsstruktur1) drastisch verschlechterte, musste ich ins Krankenhaus, in ein psychiatrisches versteht sich. Nach wenigen Monaten kündigte mir mein Arbeitgeber und meine Kund_innen aus selbstständiger Tätigkeit suchten sich eine andere Dienstleisterin (verständlich, zumindest Letzteres). Ca. 5 Monate war ich von der Bildfläche verschwunden, mein mir ohnehin nur spärlich möglicher (wegen meiner Erkrankung/en) politischer Aktivismus fror ein, soziale Kontakte brachen ab und Freund_innen (nicht alle! Es verfestigten sich zeitgleich andere <3.) suchten (mal wieder) das Weite. Als ich Mitte August nach Hause kam, war ich in noch desolaterem Zustand als vorher, denn ich hatte eine abgebrochene, versuchte Traumatherapie hinter mir (hierzu wird in nächster Zeit ein weiterer Artikel erscheinen, in dem dezidiert über das Erlebnis mit – missglückter – Traumatherapie berichtet wird). Diese wurde mir im Krankenhaus empfohlen, weil monatelanges Rumdoktern an meiner Psyche erfolglos blieb; hätte ich eine Traumatherapie erst einmal hinter mir, würde auch alles andere nach und nach besser.
Fehlsch(l)uss.
Dieser Tiefschlag im letzten Jahr war nicht der erste in den letzten Jahren. Er war vielmehr der dritte innerhalb der letzten 4 Jahre. Davor ging es mir lange Zeit einigermaßen gut (so gut es einer eben gehen kann mit Traumafolgestörungen und rezidivierender depressiver Erkrankung) und ich führte ein stabiles und gesellschaftlich (einigermaßen) unauffälliges Leben. Vor vier Jahren erreichte mich dann nach langer Zeit wieder ein massiver gesundheitlicher Einbruch. Von der Traumafolgestörung abgesehen: Eine schwere Depression ist unendlich schmerzhaft und mit ihr geht einher, dass eine sich genauso unendlich schämt. Dafür, einfach nichts mehr zu schaffen. Auch nicht, eine Packung Pommes in den Ofen zu schieben. Depressionen erzeugen Schmerzen in Körper und Seele, die unerträglich sind. Wenn ich jetzt an diese Zeit zurück denke, breche ich in Tränen aus, Tränen, die ich während der Depression nicht weinen konnte (ich hätte so gerne gewollt!). Und nachdem es mir wieder besser ging, dauerte es kein Jahr, bis der nächste Schub kam. Und dann, dann wurden die Abstände immer kürzer, die Abstände zwischen gut und schlecht gehen und durch einen Auslöser in meinem familiären Umfeld fiel ich Anfang des letzten Jahres so tief, dass ich, im Rahmen einer dissoziativen Amnesie, einen Haufen Medikamente aus meinem Tablettenfundus – von dem ich bis dato nicht mal wusste, dass er existiert – in mich reinstopfte.
Weiterlesen